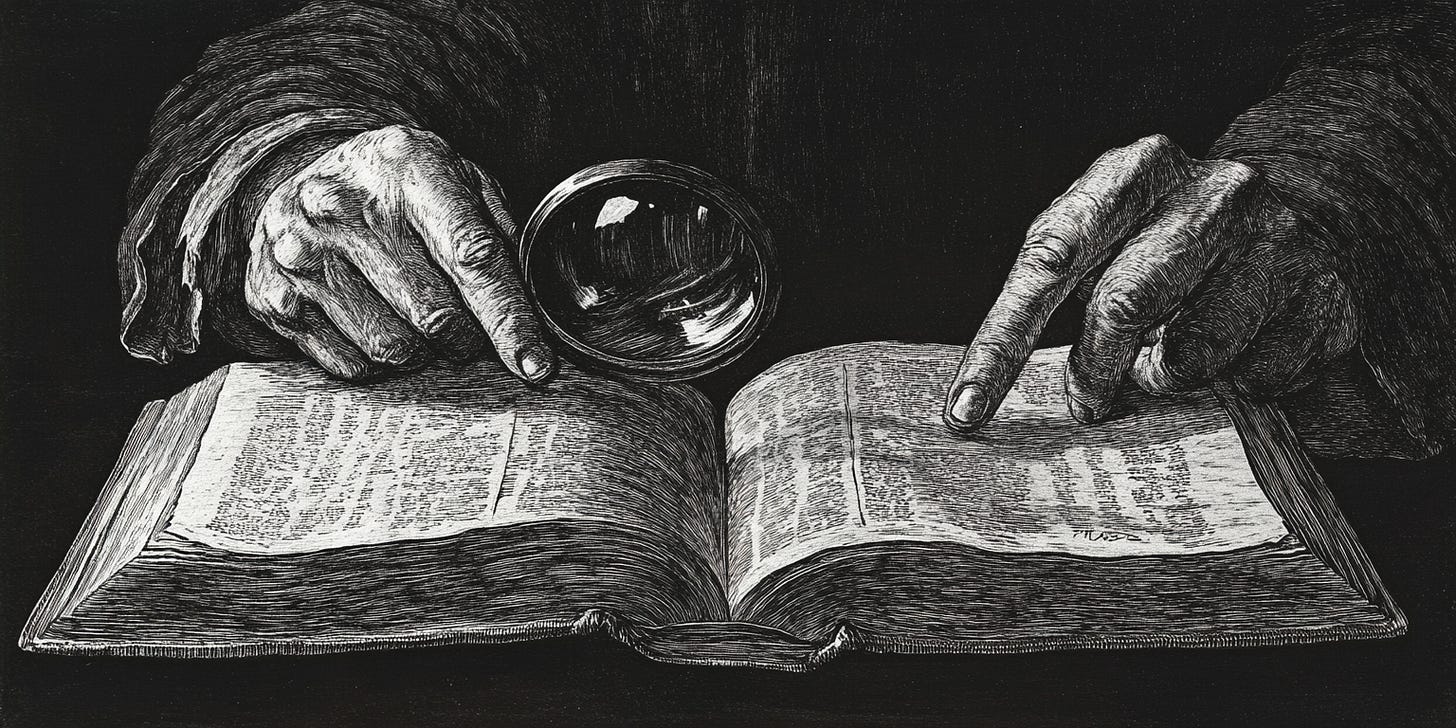Blick in die Forschung: Exploring Gender Bias - Ceci et al., 2023
Gender Bias in der Wissenschaft revisited
Zur Einordnung: In der neuen Reihe „Blick in die Forschung“ stelle ich aktuelle Studien vor, die unsere Wahrnehmung von Wissenschaft und Gesellschaft schärfen oder differenzieren.
TLDR: Ceci et al. (2023) werfen einen differenzierten Blick auf Gender Bias in der Wissenschaft: In vier von sechs Bewertungsfeldern zeigt sich heute kein systematischer Nachteil für Frauen – doch bei Lehrbewertungen und Gehältern bleiben geschlechtsspezifische Verzerrungen bestehen. Der Beitrag diskutiert die empirische Lage jenseits einfacher Narrative und plädiert für eine Gleichstellungspolitik, die auf präzise Diagnosen statt pauschale Annahmen setzt.
Ceci et al. (2023): Ein differenzierter Blick auf sechs Bewertungsfelder
Letzte Woche berichtete ich über eine Revision einer sehr bekannten Studie von Moss-Racusin (2012). In der originalen Studie wurde den STEM Feldern ein Bias gegenüber Frauen ausgewiesen, dieser Bias konnte jedoch in einer aktuellen Replikation (Honeycutt et al., 2020) mit einem größeren Sample nicht mehr gefunden werden. Der heutige Artikel reiht sich hier ein, denn Zweifel an einem starken Gender-Bias gegen Frauen in der Wissenschaft zeigen sich nicht nur in der Replikation von Moss-Racusin, sondern auch in anderen Studien, von denen ich heute eine besonders umfangreiche vorstellen möchte.
Ein Forschungsteam um Ceci hat 2023 eine umfassende Synthese veröffentlicht. Was sagen aktuelle Studien tatsächlich über Gender Bias in der Wissenschaft? Die Autorinnen und Autoren analysieren sechs zentrale Felder wissenschaftlicher Bewertung und ergänzen ihre Übersicht um eine eigene Meta-Analyse zur Produktivität von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Der Fokus liegt auf Studien ab dem Jahr 2000.
Was wurde untersucht?
Die Studie nimmt sechs Bewertungsbereiche in den Blick, die über akademischen Erfolg maßgeblich mitentscheiden:
Einstellungen auf Tenure-Track-Stellen (gerade in den USA sehr üblich)
Bewilligungen von Forschungsförderung
Begutachtungen wissenschaftlicher Artikel
Empfehlungsschreiben
Gehälter
Lehrveranstaltungsbewertungen durch Studierende
Dazu kommt eine Analyse der durchschnittlichen Publikationsleistung nach Geschlecht, die als Hintergrundfaktor für viele Bewertungen relevant ist, selbst aber kein „Bias“ im engeren Sinn darstellt.
Wie wurde untersucht?
Ceci et al. stützen sich auf über 80 Einzelstudien, darunter randomisierte Kontrollstudien, Beobachtungsdaten und systematische Reviews. Der Schwerpunkt liegt auf hochrangigen Fachzeitschriften und empirisch belastbaren Designs. Der geografische Fokus liegt auf den USA – doch auch zahlreiche europäische Studien sind in die Auswertung eingeflossen, diese habe ich unten in den Quellen nochmal spezifisch gelistet.
So berücksichtigen die Autorinnen und Autoren etwa:
Meta-Analysen zur Drittmittelvergabe, in denen auch Daten des European Research Council und deutscher oder skandinavischer Förderinstitutionen einbezogen wurden,
Untersuchungen aus Großbritannien, Schweden, den Niederlanden und Deutschland zu Auswahlverfahren, Empfehlungsschreiben und der Wirkung von Geschlecht auf Lehrevaluationen,
sowie komparative Reviews, die systematische Unterschiede zwischen Hochschulsystemen mitdenken.
Besonders hervorzuheben ist die methodische Differenzierung:
Studien mit experimentellem Design (etwa Bewerbungsunterlagen mit männlich oder weiblich codierten Namen) werden separat betrachtet.
Bei Beobachtungsstudien wird berücksichtigt, ob Unterschiede durch Drittvariablen wie Fachrichtung, akademische Alterskohorte oder Publikationsleistung erklärbar sind.
In mehreren Bereichen führen die Autorinnen und Autoren eigene Mini-Metaanalysen durch, um widersprüchliche Befunde systematisch einzuordnen.
Ziel ist kein lückenloser globaler Überblick, sondern eine möglichst evidenzgestützte Antwort auf die Frage: In welchen akademischen Bewertungssituationen lassen sich heute noch geschlechtsspezifische Verzerrungen nachweisen – und wo nicht?
Was zeigt sich?
In vier der sechs Felder zeigt sich kein systematischer Nachteil für Frauen. Berufungsverfahren, Fördermittelvergabe, Peer Review und Empfehlungsschreiben verlaufen heute im Schnitt geschlechtsneutral. Teilweise zeigt sich sogar ein leichter Vorteil für Bewerberinnen, etwa bei gleich starken Bewerbungsunterlagen.
Kritischer sind die Befunde zu Lehrveranstaltungsbewertungen und Gehältern. Dozentinnen erhalten – bei vergleichbarer Leistung – systematisch schlechtere Rückmeldungen von Studierenden, häufiger begleitet von stereotypen Zuschreibungen.
Auch beim Einkommen besteht eine Lücke, die sich nicht vollständig durch Produktivitätsunterschiede erklären lässt. Selbst bei identischem Publikationsoutput bleibt ein Restunterschied von rund vier Prozent bestehen.
Die Unterschiede in der Publikationsleistung selbst – Männer publizieren im Mittel häufiger – wirken sich zudem indirekt auf andere Bewertungen aus. Ceci et al. argumentieren jedoch, dass diese Unterschiede eher strukturell oder biografisch vermittelt sind als das Ergebnis direkter Diskriminierung.
Zusammengefasst: In vier Feldern kein Nachteil für Frauen, in zwei Feldern (Lehrbewertungen, Gehälter) bleiben Probleme bestehen.
Warum ist das relevant?
Weil das Bild, das die Studie zeichnet, sich einfachen Erzählungen entzieht. Wer in jeder Bewertungssituation einen Gender Bias vermutet, irrt ebenso wie jene, die das Thema für erledigt erklären. Damit ist man allerdings nicht allein: Wie Schaerer et al. (2023) zeigen, neigen sowohl Fachleute als auch Laien dazu, das Ausmaß von Gender Bias zu überschätzen. Die Realität ist differenzierter und vermutlich besser, als viele denken. Gerade das macht sie analytisch anspruchsvoll, aber politisch umso relevanter.
Eine Gleichstellungspolitik, die auf pauschale Bias-Vermutungen baut, läuft Gefahr, an den realen Problemstellen vorbeizugehen. Es braucht gezielte Maßnahmen und den Mut, empirische Komplexität auszuhalten. Deshalb ist auch ein solides Monitoring notwendig. Nur wer die Zahlen im eigenen Haus kennt, kann angemessen reagieren. Denn auch wenn Ceci und Kolleg*innen zeigen, dass "on average" Bias deutlich zurückgegangen ist, gilt das nicht automatisch für jede Institution oder jeden Einzelfall. Gleichwohl legen sowohl diese Studie als auch die von Honeycutt nahe, dass die systematische Benachteiligung von Frauen in den untersuchten Kontexten in den letzten Jahren spürbar abgenommen hat. Daran hat die Gleichstellungsarbeit neben allgemeinen gesellschaftlichen Veränderungen vermutlich einen nicht unerheblichen Anteil. Sie darf diesen Erfolg daher auch selbstbewusst für sich reklamieren.
Quellen
Ceci, S. J., Kahn, S., & Williams, W. M. (2023). Exploring gender bias in six key domains of academic science: An adversarial collaboration. Psychological Science in the Public Interest, 24(1). https://doi.org/10.1177/15291006231163179
Honeycutt, N., Careem, A., Lewis, N. A., & Jussim, L. (2020). Are STEM Faculty Biased Against Female Applicants? A Robust Replication and Extension of Moss-Racusin and Colleagues (2012). https://doi.org/10.31234/osf.io/ezp6d
Schaerer, M., du Plessis, C., Nguyen, M. H. B., van Aert, R. C. M., Tiokhin, L., Lakens, D., Giulia Clemente, E., Pfeiffer, T., Dreber, A., Johannesson, M., Clark, C. J., & Luis Uhlmann, E. (2023). On the trajectory of discrimination: A meta-analysis and forecasting survey capturing 44 years of field experiments on gender and hiring decisions. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 179, 104280. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2023.104280
In Ceci et al., (2023) verwendete europäische Studien (oder Meta-Analysen in denen auch europäische Studien einbezogen sind):
Bornmann, L., Mutz, R., & Daniel, H.-D. (2007). Gender differences in grant peer review: A meta-analysis. Journal of Informetrics, 1(3), 226–238. https://doi.org/10.1016/j.joi.2007.03.001
Marsh, H. W., Bornmann, L., Mutz, R., Daniel, H.-D., & O’Mara, A. (2009). Gender effects in the peer reviews of grant proposals: A comprehensive meta-analysis. Review of Educational Research, 79(3), 1290–1326. https://doi.org/10.3102/0034654309334143
Mutz, R., Bornmann, L., & Daniel, H. (2012). Does gender matter in grant peer review? Zeitschrift für Psychologie, 220(2), 121–129. https://doi.org/10.1027/2151-2604/ a000103
van der Lee, R., & Ellemers, N. (2015). Gender contributes to personal research funding success in The Netherlands. PNAS, 112(40), 12349–12353. https://doi.org/10.1073/pnas.1510159112
Boring, A. (2017). Gender biases in student evaluations of teaching. Journal of Public Economics, 145, 27–41. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2016.11.006
Mengel, F., Sauermann, J., & Zölitz, U. (2019). Gender bias in teaching evaluations. Journal of the European Economic Association, 17(2), 535–566. https://doi.org/10.1093/jeea/jvx057
Bornmann, L., & Daniel, H.-D. (2005). Selection of research fellowship recipients by committee peer review. Scientometrics, 63(2), 297–320. https://doi.org/10.1007/s11192-005-0214-2
Sandström, U., & Hällsten, M. (2008). Persistent nepotism in peer-review. Scientometrics, 74(2), 175–189. https://doi.org/10.1007/s11192-008-0211-3
Henningsen, L., Horvath, L. K., & Jonas, K. (2021). Affirmative action policies in academic job advertisements: Do they facilitate or hinder gender discrimination in hiring processes for professorships? Sex Roles, 86, 34–48. https://doi.org/10.1007/s11199-021-01251-4